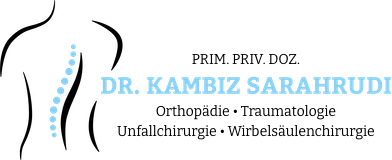Osteoporotische Wirbelkörpereinbrüche
Bedingt durch die Abnahme der Knochendichte und die Schwächung des Knochens kommt es bei der Osteoporose leicht zu Entstehung von Knochenbrüchen. Am gefährdetsten sind der Schenkelhals, die Speiche sowie Wirbelkörper der unteren Brust- und Lendenwirbelsäule. Oft sind Minimaltraumata (z.B. leichtes Stürzen) ausreichend, um osteoporotische Wirbelkörpereinbrüche zu verursachen. Symptome sind
- unterschiedlich starke Schmerzen der Wirbelsäule, die vor allem während der Belastung (Gehen oder Stehen) stärker werden, und
- Bewegungseinschränkung.
Bei den meisten osteoporotischen Wirbelkörpereinbrüchen handelt es sich um sogenannte stabile Frakturen, die sowohl konservativ als auch operativ behandelt werden können.
Konservativ
Die konservative Therapie bei Wirbelkörpereinbrüchen besteht aus einer Fixation durch äußere Stützverbände (Mieder oder Korsett) sowie Schmerztherapie. Sobald die Akutschmerzen nachlassen, wird zusätzlich zur Stärkung der Rückenmuskulatur eine begleitende physiotherapeutische Behandlung begonnen.
Operativ
Sollte trotz der konservativen Behandlung bei Wirbelkörpereinbrüchen keine ausreichende Abnahme der Schmerzen erfolgen, oder aber zu einer weiteren Sinterung (Kompression) des gebrochenen Wirbelkörpers kommen, kommt eine operative Therapie in Frage. Bei stabilen Brüchen kann eine Kyphoplastie oder Vertebroplastie vorgenommen werden. Bei instabilen Brüchen kann unter Umständen eine zusätzliche Stabilisierung notwendig sein.
Kyphoplastie
Die Kyphoplastie kann in Allgemeinnarkose aber auch in Lokalanästhesie durchgeführt werden. Durch zwei kleine Schnitte am Rücken (jeweils 1 cm) wird eine Hohlnadel in den gebrochenen Wirbelkörper platziert. Die korrekte Platzierung wird dabei mittels Röntgen kontrolliert. Über die Hohlnadel wird ein Ballonkatheter in dem Wirbelkörper eingeführt. Durch das Aufblasen des Ballons wird der Wirbelkörper in die ursprüngliche Form zurück gebracht. Danach kann der Ballon entfernt und der entstandene Hohlraum über die Hohlnadel mit einem Flüssigzement aufgefüllt werden. Der Zement verhärtet sich innerhalb von wenigen Minuten und stabilisiert den gebrochen Wirbelkörper von innen. In der Regel lassen die Schmerzen bereits am Tag nach der OP deutlich nach, sodass der Patient bereits voll mobilisiert werden kann und 2 Tage nach der OP das Krankenhaus verlassen kann.
Vertebroplastie
Die Vertebroplastie wird für ältere Frakturen angewendet. Das Vorgehen ist mit der Kyphoplastie ident. Der einzige Unterschied liegt darin, dass bei der Vertebroplastie auf die Aufrichtung des Wirbelkörpers mit dem Ballon verzichtet wird. Das heißt, dass der Zement direkt (ohne vorherige Aufrichtung) in den gebrochenen Wirbelkörper injiziert wird.
Die Vorteile der operativen Behandlungsmethoden (Kyphoplastie, Vertebroplastie) liegen in der deutlich Schmerzreduktion innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Operation, damit verbunden ein geringer Bedarf an Schmerzmittel und bessere Lebensqualität durch die wiedererlangte Mobilität. Die Eingriffe sind äußerst schonend und können innerhalb von 20 – 30 Minuten durchgeführt werden.
Wirbelkörperfrakturen
auch: Wirbelbruch, Wirbelfraktur, Wirbelkörpereinbruch
Versorgung instabiler Wirbelkörperfrakturen im Bereich Brust- oder Lendenwirbelsäule
Als Folge von Verkehrsunfällen, Sturz aus großer Höhe oder als Folge der Sportunfälle kommt es nicht selten zur Entstehung von instabilen Wirbelkörperbrüchen im Bereich der Hals-, Brust- oder Lendenwirbelsäule. Hierbei entstehen nicht nur Trümmerbrüche des Wirbelkörpers alleine sondern es kommt auch zur Beteiligung der Wirbelgelenke, Verletzung der Bandscheibe, des Bandapparates und der Muskulatur. Um weitgehende Schädigung der Wirbelsäule und des Rückenmarkes zu vermeiden müssen diese Brüche operativ behandelt werden.
Die operative Behandlung ist je nach Wirbelsäulenregion, Verletzung des Rückenmarks, Art des Bruches, Stabilität/Intensität, Alter und Allgemeinzustand des Patienten unterschiedlich.
Instabile Brüche im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule werden nach Einrichtung zunächst von dorsal (rückenseitig) mit Schrauben und Stangen stabilisiert. Diese Stabilisierung kann minimal invasiv durch wenige Hautschnitte von jeweils 1 – 2 cm erfolgen. Wenn es durch die Bruchstücke zu einem Druck auf dem Rückenmark kommt, kann es zu Lähmungserscheinungen (unterschiedlicher Intensität bis hin zu kompletten Querschnittslähmung) kommen. In diesem Fall muss eine zusätzliche Dekompression des Rückenmarkes vorgenommen werden. Wenn der Berstungsgrad des Wirbelkörpers es erlaubt, kann zusätzlich zur Stabilisierung mit Schrauben und Stange eine Kyphoplastie des gebrochenen Wirbelkörpers mit resorbierbarem (sich selbstauflösenden) oder nicht-resorbierbarem (nicht selbstauflösenden) Zement durchgeführt werden, um eine ventrale (von der Bauchseite) Stabilisierung zu vermeiden. Je nach Knochenqualität und Grad der Wirbelinstabilität kann zusätzliche eine Stabilisierung von ventral (von der Bauchseite) erforderlich sein. Diese erfolgt gewöhnlich in einem 2. Eingriff einige Tage nach dem Ersteingriff. Die ventrale Stabilisierung erfolgt endoskopisch (Schlüsselloch-Technik) ebenfalls mit kleinen Hautschnitten.
Bandscheibenvorfall
Die allermeisten Bandscheibenvorfälle können konservativ behandelt werden. Die konservative Therapie besteht aus einer schrittweisen Kombination von Schmerztherapie, Physiotherapie und gezielte Infiltration.
Bei neurologischen Ausfällen (Lähmungen) und bei Erfolglosigkeit der konservativen Therapie wird eine operative Entfernung der Bandscheibe notwendig.
Spinalkanalstenose (Wirbelkanalstenose)
Die Einengung des Rückenmarkkanals führt zur Kreuz- und Beinschmerzen sowie zu einer erheblichen Verkürzung der Gehstrecke. Oft müssen Patienten nach einer kurzen Gehstrecke stehen bleiben. Das Voranschreiten kann bis zur völligen Einschränkung der Mobilität führen.
Die operative Behandlung besteht in einer Dekompression (Erweiterung) der eingeengten Struktur.
Mehr über Wirbelkanalstenose (Aufzeichnung „Meryn am Montag: Wirbelkanalstenose“).
Spondylolisthese (Wirbelgleiten)
Wenn sich einzelne Wirbelkörper gegeneinander verschieben wird von einer Spondylolisthese oder Wirbelgleiten gesprochen. Ursache ist in den meisten Fällen die Abnützung der Bandscheibe aber auch Unfälle oder Fehlbildungen können zu einem Wirbelgleiten führen.
Auch hier ist zunächst eine konservative Therapie möglich und auch sinnvoll. Sollte die konservative Therapie nicht den gewünschten Effekt bringen, kann eine operative Versteifung der gleitenden Wirbelkörper durchgeführt werden.
Facettengelenkssyndrom
Das Facettensyndrom (Spondylarthrose) ist ein lokaler tiefsitzender Kreuzschmerz (mit möglicher Ausstrahlung in den Beinen), welcher durch eine Erkrankung / Veränderung der Wirbelgelenke eines oder mehrerer Bewegungssegmente ausgelöst wird. Man nimmt an, dass die lumbalen Facettengelenke (bzw. ein Facettengelenks-Syndrom) in 10 – 41 % primär ursächlich für chronische Kreuzschmerzen sind.
Mehr über Ursache und Behandlung bei Facettengelenkssyndrom
Wirbelkörpermetastasen
Die zunehmende Lebenserwartung von Tumorpatienten führt zu einem zunehmenden Behandlungsbedarf bei Wirbelsäulenmetastasen. Ein Therapiekonzept muss interdisziplinär in einem sog. Tumorboard erstellt werden. Entscheidend für die chirurgische Behandlung der Wirbelkörpermetastase ist die Stabilitätsgefährdung der Wirbelsäule und drohende Lähmungserscheinungen. In solchen Fällen kann eine operative Stabilisierung und Dekompression durchgeführt werden. Auch eine minimalinvasive Therapie durch Zementeinspritzung (Kyphoplastie/Vertebroplastie) kann in Frage kommen und durchgeführt werden.
Eingriffe an der Halswirbelsäule
Verletzungen an der Halswirbelsäule (HWS)
Häufigste Ursachen der HWS (Halswirbelsäule) Verletzungen sind Stürze, Reitunfälle, Hochrasanztrauma (Verkehrsunfall) oder Kopfsprünge ins seichte Wasser. Bei osteoporotischen Menschen genügt häufig auch ein Sturz mit Anschlagen der Stirn an einer Kante um z.B. eine Fraktur im Bereich des 2. Halswirbels zu verursachen. Hierbei können nicht nur Brüche der Halswirbelkörper entstehen, sondern auch Verletzungen der Bänder, der Bandscheibe oder Verrenkungen der Wirbelkörper mit daraus resultierender Instabilität.
Symptom sind heftige Nackenschmerzen und Bewegungseinschränkung der HWS. Zusätzlich kann die Verletzung der HWS mit einer Verletzung des Halsmarkes und mit neurologischen Ausfallserscheinungen einhergehen.
Therapie
Die Entscheidung zu konservativer oder operativer Behandlung hängt von der Verletzungsform und der neurologischen Symptomatik ab. Die Verletzungsform bestimmt die Stabilität oder Instabilität und in der Folge auch die Art der Therapie. Bei der konservativen Therapie muss zwischen einer vorläufigen konservative (mit anschließender Operation) und einer definitiven konservativen Therapie unterschieden werden.
Konservative Behandlungsmöglichkeiten:
- Schanz-Krawatte (weiche Schanz-Krawatte oder härtere Orthesen)
- Ruhigstellung mit Halo-Fixateur -Gipsverband
Operative Behandlungsmöglichkeiten:
- Dorsale Fusion des 1. und 2. Halswirbelkörpers
- Verblockung der Gelenke des 1. und 2. Halswirbelkörpers
- Densverschraubung
- Ventrale Fusion
- Dorsale Fusion